Eva Kurowski ist eine Kartographin des Ruhrgebiets, welches sie so detailgetreu nachzeichnet, dass das Abbild mit der Wirklichkeit deckungsgleich wird, um alsbald in dieser zu zerfallen.

Der Ausdruck „Fräuleinwunder“ ist Teil der Wunderrepublik-Begriffe der Nachkriegszeit der BRD wie „Wirtschaftswunder“ und „Wunder von Bern“ 1954.
Der Begriff Fräuleinwunder wurde 1999 für eine neue Generation junger deutscher Autorinnen verwendet, die Bezeichnung kam in einem Artikel des Literaturkritikers Volker Hage auf. Zu diesem Fräuleinwunder der deutschen Literatur zählen junge Autorinnen, die gerade ihre ersten Bücher veröffentlicht hatten, z. B. Julia Franck, Judith Hermann, Zoë Jenny und Juli Zeh. Im Gegensatz zu diesen ´Girlies` hat Eva Kurowski als gestandene Frau einen klaren Klassenstandpunkt, sie berichtet über eine „sozialistische Kindheit im Ruhrgebiet“.
„Auch heute noch, nachdem er sich 200 Jahre in der Lesewelt befindet, gilt von Laurence Sternes ‚The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman‘ das Urteil, dass es zu den 10 größten Büchern gehörte, die bisher in englischer Sprache geschrieben worden sind.“
Arno Schmidt
Ähnlich wie bei »The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman« von Laurence Sterne, beginnt die Geschichte von Eva Kurowski vor der Geburt: „Es begann damit, dass mein Vater, der ein begeisterter Trompeter, Marxist und Grafiker war, einen Samenerguss hatte, und zwar in meiner Mutter.“ Frei von der Leber weg berichtet die ‚Disöse’ Eva Kurowski in Gott schmiert keine Stullen. Die Autorin ist eine ironische Realistin, sie schreibt einen biographischen Text, der alle Nuancen der Welt- und Ich-Erfahrung aufnimmt und in Sprachklang umsetzt. Ihr Buch liest sich wie ein über Jahre gereiftes Initiationsbuch einer Autorin, die darin ihre Berufung zur Schrift schildert. Indem sie ihre Leser auf falsche Fährten lockt, führt sie sie auf die richtige Spur.
Luther Blissett veredelt Trash in diesen Streifzug durch die De-Industrialisierung als transhistorisch und transkulturell. Es geht um die Funktion einer „nonkonformistischen“ Kunst im speziellen Kontext der Ruhrgebeatsgeschichte.
Gott schmiert keine Stullen besteht aus Simulakren, aus quasi parodistischen Nachahmungen des wirklichen Lebens, wir treffen Edelkurt, Jerko, Fasia Jansen und Helge Schneider, also lebensechte Menschen aus der Metropolenregion. Bei dieser ´sozialistischen Kindheit` im Ruhrgebiet ist niemand gleichgeschaltet. Jeder lebt im Ruhrpott sein Drama; jeder ein anderes. Eva Kurowski weiß es, und sie gestaltet diese Dramen ebenso gewaltig wie zart. Ihre halluzinativ genaue Wiedergabe von Geringfügigkeiten, in deren Verkettung ein Ort und eine Zeit decodierbar werden, macht sie zur Post-Pop-Autorin. „Im Hinterhalt des Alltags sind wir verlorene Kinder“, scheint es immer wieder aus dem Subtext von »Gott schmiert keine Stullen« zu raunen. Doch haben einige die Chance, das Ganze selbstbestimmter zu bestehen.
Die Proletendiva aus Oberhausen-Eisenheim ist eine Heimatdichterin fern aller Folklore sowie eine Reiseschriftstellerin im eigenen Hinterhof.
Als eine Art Astrud Gilberto des Indiepops ist Eva Kurowski stets etwas feinsinnig und mit einem feinen Hang zur Melancholie. Und auch immer etwas spröde. Was bei ihrer CD Reich ohne Geld an lächelnder Schwermut antönt, findet sich auf knapp 200 Seiten in »Gott schmiert keine Stullen«, ihre eigentliche Kunst bleibt ganz an der Oberfläche – dort findet sie das Eigentliche -, fast hält sie die Firnis, die unmittelbarste, epidermische Wirklichkeit fest. Eva Kurowskis Menschenporträts, von Erörterungen der eigenen Zerrissenheit durchwirkt, verdichten sich zum Sittengemälde des Ruhr-ge-Beats. Ihre kompositorische Wurstigkeit macht sie mit Ansätzen zur Konzeptkünstlerin avant la lettre wett. Das entfesselte Wort wird in »Gott schmiert keine Stullen« zu einem erstaunlichem Buch: Es kommt unangestrengt daher, entfaltet seine Lebensklugheit ohne Belehrsamkeit und erweist sich überdies auch bei der Re:Lektüre als großes Lesevergnügen.
***
Gott schmiert keine Stullen von Eva Kurowski, rowohlt, 2012
Reich ohne Geld, CD mit „Dschäzzz“ von Eva Kurowski, roofmusic, Bochum, 2001
When Lights Are Low von A’dam Quartet, feat. Eva Kurowski, 2018
Das Hungertuch, die Dokumentation zum Künstlerpreis erschien mit einem Originaldruck von Haimo Hieronymus bei der Edition Das Labor, Mülheim 2019
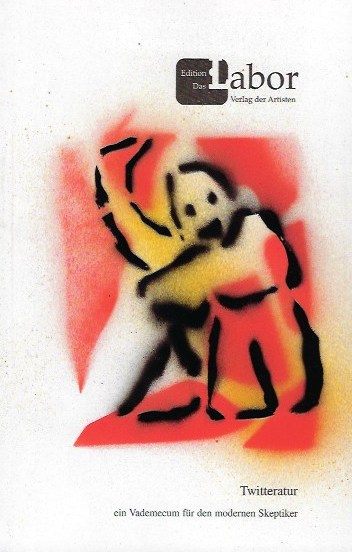
Weiterführend → Die Deutsche Kritik neigt dazu, klüger als die Kunst sein zu wollen. Dies zu ändern ist im Jahr 2001 der Kunstförderer Ulrich Peters angetreten und hat mit dem Hungertuch einen Künstlerpreis gestiftet, der seit seinem Bestehen von Künstlern an Künstler verliehen wurde. Es gibt im Leben unterschiedliche Formen von Erfolg. Zum einen gibt es die Auszeichnung durch Preise und Stipendien, zum anderen die Anerkennung durch die Kolleginnen und Kollegen. Dies manifestiert sich in diesem Künstlerpreis mit spielerischer Leichtigkeit. @ last, ein Rückblick auf den Hungertuchpreis.
→ In der Reihe Gossenhefte zeigt sich, was passiert, wenn sich literarischer Bodensatz und die Reflexionsmöglichkeiten von populärkulturellen Tugenden nahe genug kommen. Der Essay Perlen des Trash stellt diese Reihe ausführlich vor. Dem Begriff Trash haftet der Hauch der Verruchtheit und des Nonkonformismus an. In Musik, Kunst oder Film gilt Trash als Bewegung, die im Klandestinen stattfindet und an der nur ein exklusiver Kreis nonkonformistischer Aussenseiter partizipiert.