
Den besten Vorwand die Gemarkung zu verlassen, bietet das größte Volksfest des Sauerlandes. Die Hüstener Kirmes ist ein Virus, sie befällt einen, während die Bewohner schlafen. Der Übergang zum Wachsein dauert kaum länger als die Monteure brauchen, um die Fahrgeschäfte auf Crange ab- und an der Riggenweide wieder aufzubauen. Zu dieser Zeit fahren die Anwohner in Urlaub… oder sie plündern ihr Sparbuch.
Da der Genuss von Bier die Sauerländer sediert, können sich auf der Hüstener Kirmes Beddel-Neime und Hüstener Kälber fast gefahrlos begegnen… und dann gemeinsam tagelang aus dem Feuerlöschschlauch saufen… zumindest solange es noch das Pils zum Korn gibt. Mit steigendem Promille–Gehalt ist der Sauerländer lärmend, kontaktfreudig und zunehmend distanzlos. Sobald die Müschkeder Lulen auf Herdrinker Kräggen treffen, sollte die Kirmesbesucher beim Ausruf: „Schmacht Hachen“ die Gefahrenzone unverzüglich verlassen.
Auch wenn die Subjektivität und Diskontinuität von Erinnerung unverlässlich bleibt, die Sauerländer eint das Stockende und verstummen Wollende der Auskünfte. Daher bietet ihnen die Hüstener Kirmes eine Parabel auf die Lebensfragen.
Unbeirrt setzten die Streithammel ihre Gratwanderungen fort und treffen sich alsbald zwischen Bier und Bratwurst wieder. Nach dem dritten Pils quatschen sie wieder, erinnern sich gemeinsam an Geschehenes, berichten es einander und versichern sich so ihrer Anwesenheit im Multiversum.
Die Neheimer glauben, sie würden akzentfreies Hochdeutsch sprechen, sie quasseln jedoch ganz frei von’ne Leber wech‘ in einem Kauderwelsch, der einiges über diese Population verrät, er transportiert eine industriell überformte Identität.
Neheimer verdrehen Sinn, Satz- und Wortstellungen; bis zur völligen Erschöpfung. Sie sagen auch bei jeder unpassenden Angelegenheit: „Hömma!“, schleifen ein: „Kär woll ehj!“ ein, sind auf fruchtloser Selbstsuche: „Kuck’se ma‘ nach wat?!?“ oder beschließen fast jeden zweiten Satz mit: „Woll?“!
Dieser Regiolekt beinhaltet kein Alleinstellungsmerkmal, es ist ein Ruhrpottslang, der zwischen Duismund und Dortburg gesprochen wird. Die Identität der Neheimer drückt sich in der Wortbildung, mehr noch in der Wortbesetzung aus. Sprache bedeutet für sie letztendlich: ob’se nützlich is‘.
„Darauf erstmal ’n Pülleken!“, ist in Neheim der Startpunkt, um einst ertrunkene Erinnerungen den Wogen des Vergessens zu entreißen… das Selbstbild der Sprechenden ist das eines Stoikers… Surländsk Platt wird nicht mehr gesprochen, die Katze geht vergeblich einer Verschwörungstheorie nach, der zufolge ein ´Bevölkerungsaustausch` stattgefunden hat…
…die Natural Born Neheimer sind trinkfest, dickköpfig unte wortkarg… sie changieren zwischen dem Vielleicht-Schönsten unte einem Absolut-Wahrhaftigen, durchleben die Diskrepanz zwischen Hoffnung unte Erfüllung, Erwartung unte Enttäuschung… Realität funktioniert in diesem selbstreferenziellen Wunderland als Eldorado der Fiktionen, das ursprüngliche Sprachverständnis schwankt an’ne Mündung der Möhne in’ne Ruhr zwischen Leichtgläubigkeit unte Argwohn…
Wenn die Hüstener Kirmes in Gang kommt, die Sauerländer ihren Herzschlag nicht mehr hören können, sondern nur noch den harten Beat aus den Lautsprechern der Fahrgeschäfte… in genau diesem Moment spüren sie ihren Puls. Fünf Tage lang, ein Herzschlag, der sie am letzten Tag bereit macht, die Sterbenssakramente zu empfangen, mit dem Bewusstsein, bis zum letzten Blutstropfen gelebt zu haben.
***
Schmieds Katze, von Johannes Schmidt. Edition Das Labor 2025
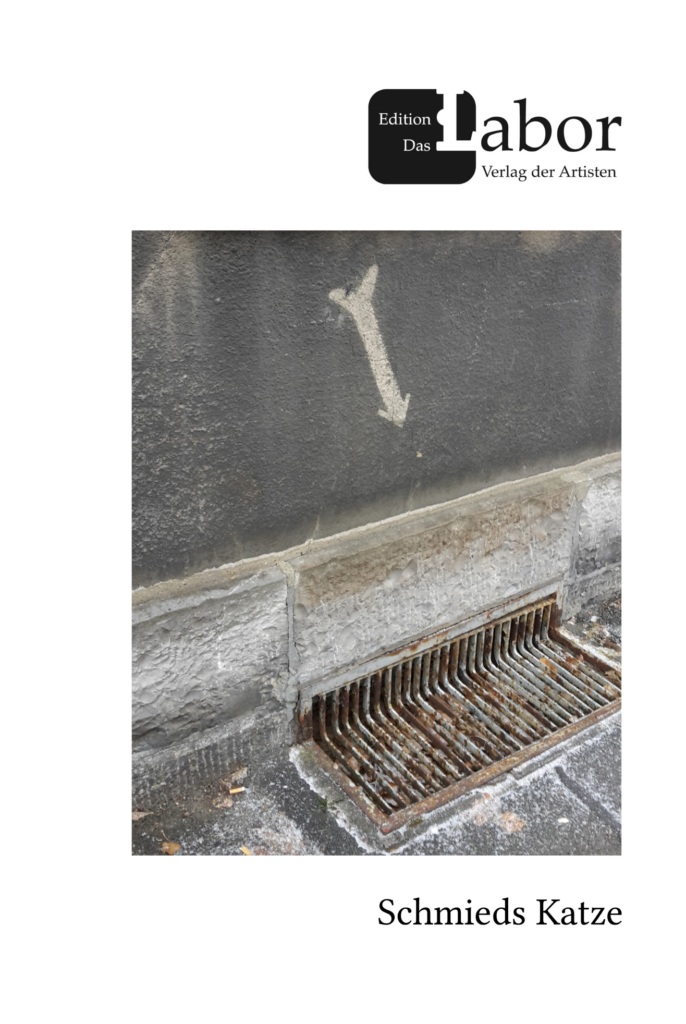
Im Befragen dessen, was Heimat ausmacht, geht es um den Verlust lokaler Identität. 5760 Neheim ist ein affektiv besetzter Ort mit ehemals prägenden Wörtern, Dialekten, Berufsbezeichnungen, ihren Erhebungen und Abgründen, ihrem lokalen Wissen, ihren geheimen Geschichten und Überlieferungen. Die Vertellstückskers zeigen, wie ´Autosoziobiografisches Schreiben` im Hinterland betrieben wird. Im Land der 1000 Berge existieren Tiefenzeiten und Rückzugsräume. Es gibt im Sauerland noch Orte, in denen die Bürger jenseits des medialen Zerstreutseins zu Hause sind, in denen natürlichen Gegebenheiten und geschichtlichem Gewordensein sie mit anderen aufgehen können. Ähnlich wie bei Annie Ernaux steht auch für den Herausgeber Johannes Schmidt die Thematisierung von Klassismus in diesen Erzählungen im Vordergrund. Er verwandelt sich in einen Kehrichtsammler der Tatsachen, die Bagatellen des täglichen Provinzlebens werden in bizarre scheinenden und möglichst unterhaltsamen Geschichten festgehalten.
Weiterführend → Der Herausgeber würdigte den Fotographen Martin Vanselow, dessen Streetphotography er sehr schätzt. Er freut sich über die Zusammenarbeit für diese Online-Publikation weil Vanselow nicht nur faszinierende Bilder aus dem Alltag hervorholt, sondern weil diese Momentaufnahmen nebenher auch großartige Sozialstudien sind.