„Sehet, welch ein Mensch!“, soll, laut einer schlampig edierten Anthologie, der römische Statthalter Pontius Pilatius über den Sohn des Zimmermanns gesagt haben.

Sehet, welch ein Mitbürger. Franz Stock, auch ein Arbeiterkind, fühlte sich zu höherem berufen und wurde Student der katholischen Theologie. Parallel zur religiösen Berufung zum Priester setzte er sich für die Völkerverständigung ein, insbesondere zwischen der deutschen und französischen Jugend.
Daher ist es sehr sinnfällig, dass er die Leitung der deutschen Gemeinde in Paris übernimmt. Stocks Gemeindewirken wird als „segensreich“ und „einfühlsam“ beschrieben. Sein Denken besticht durch Schlichtheit und Eleganz. Er machte kulturelle Angebote, veranstaltete Ausflüge und schuf Orte der Begegnung mit Franzosen und Nichtkatholiken.
Nach der Besetzung von Paris durch die deutsche Wehrmacht wurde er zum Seelsorger für die Deutschen in Paris ernannt. Als nebenamtlicher Standortpfarrer begann er 1941 mit seiner Tätigkeit in den Pariser Wehrmachtsgefängnissen Fresnes, La Santé und Cherche Midi. Ihm oblag die Betreuung der Häftlinge, insbesondere der zum Tode Verurteilten. Oft erreichte er, dass Todesurteile abgemildert oder die Zahl der Geiselerschießungen reduziert wurde.
Zeugnisse der Überlebenden dokumentieren Stocks aufopferungsvollen Dienst an den Verurteilten, seine Menschlichkeit und sein Zugehen auf andere, ohne sich selbst zu schonen. Da die Gefangenen von der Besatzungsmacht oft bewusst im Unklaren über das Schicksal ihrer Familien gelassen wurden, war es eine große Hilfe für sie, dass Stock Kontakt zu den Familien hielt und den Gefangenen Nachrichten übermittelte.
Nach der Befreiung von Paris blieb Abbé Stock in Paris und half im Hôpital la Pitié, mehr als 600 nicht transportfähige, verwundete deutsche Soldaten zu betreuen. Die US-Armee verhaftete ihn, was den Abbé jedoch nicht daran hinderte, ein Priesterseminar für kriegsgefangene, deutschsprachige Priester und Seminaristen zu gründen. Franz Stock wurde auf Initiative der französischen Regierung und mit geistlicher Unterstützung des Apostolischen Nuntius gebeten, eine Institution unter dem Bezeichnung „Stacheldrahtseminar“ zu leiten.
Die Schutzbedürftigkeit hörte niemals auf… am 24. Februar 1948 starb der Patron der versehrten Seelen völlig unerwartet in Paris. Er wurde auf dem Pariser Friedhof Thias beerdigt. Nuntius Roncalli nahm die Aussegnung des Toten vor:
»Abbé Franz Stock – er ist nicht nur ein Name – er ist ein Programm«! Eine Aussage, die er als Papst Johannes XXIII. wiederholte. Zur Seligsprechung reichte es nicht, was weniger über den Menschen, sondern mehr über die Institution aussagt.
Eine verbürgte Geschichte als lineare Entwicklungserzählung hat ihre identitätsstiftende und verbindende Kraft verloren… Die Sauerländer glaubten, sich von Göttern befreit zu haben, sie folgen jedoch neuen Autoritäten oft ebenso blind wie die Menschen im Mittelalter ihren Päpsten.
Immerhin gibt es neben der St. Johannes-Kirche in Neheim ein Denkmal, dass an diesen aufopferungsvollen Förderer der deutsch/französischen Freundschaft erinnert; auch wenn die künstlerische Qualität befragbar ist. Selbst einer der Seligen kann sich nicht dagegen wehren, wenn Tauben sein Denkmal vollkoten. Die Taubenscheiße erinnert mit ihrer existenziellen Schärfe daran, dass die Historie eine Schule der Hoffnungslosigkeit ist. Daher braucht Neheim solche Menschen wie Franz Stock, er stellt sich nicht über, sondern neben uns.
***
Schmieds Katze, von Johannes Schmidt. Edition Das Labor 2025
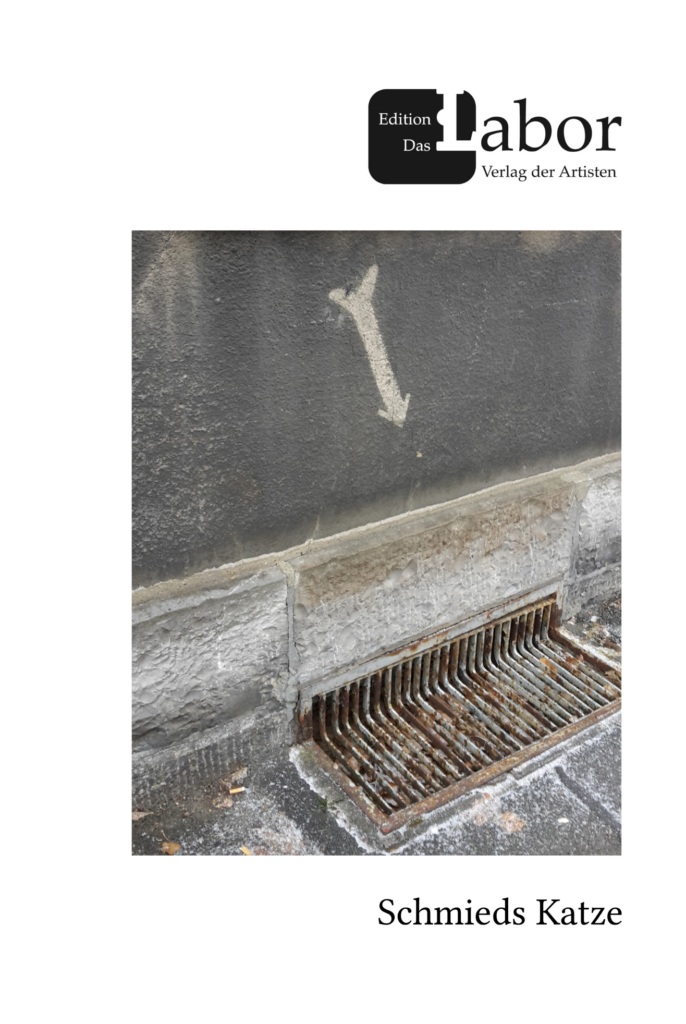
Im Befragen dessen, was Heimat ausmacht, geht es um den Verlust lokaler Identität. 5760 Neheim ist ein affektiv besetzter Ort mit ehemals prägenden Wörtern, Dialekten, Berufsbezeichnungen, ihren Erhebungen und Abgründen, ihrem lokalen Wissen, ihren geheimen Geschichten und Überlieferungen. Die Vertellstückskers zeigen, wie ´Autosoziobiografisches Schreiben` im Hinterland betrieben wird. Im Land der 1000 Berge existieren Tiefenzeiten und Rückzugsräume. Es gibt im Sauerland noch Orte, in denen die Bürger jenseits des medialen Zerstreutseins zu Hause sind, in denen natürlichen Gegebenheiten und geschichtlichem Gewordensein sie mit anderen aufgehen können. Ähnlich wie bei Annie Ernaux steht auch für den Herausgeber Johannes Schmidt die Thematisierung von Klassismus in diesen Erzählungen im Vordergrund. Er verwandelt sich in einen Kehrichtsammler der Tatsachen, die Bagatellen des täglichen Provinzlebens werden in bizarre scheinenden und möglichst unterhaltsamen Geschichten festgehalten.
Weiterführend → Der Herausgeber würdigte den Fotographen Martin Vanselow, dessen Streetphotography er sehr schätzt. Er freut sich über die Zusammenarbeit für diese Online-Publikation weil Vanselow nicht nur faszinierende Bilder aus dem Alltag hervorholt, sondern weil diese Momentaufnahmen nebenher auch großartige Sozialstudien sind.